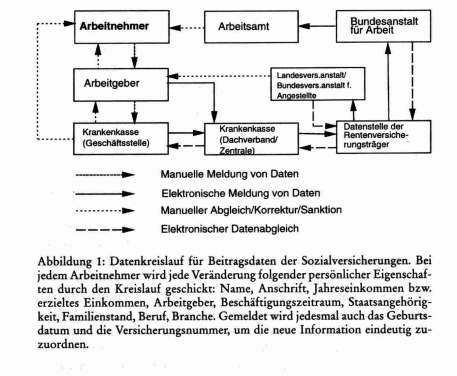
Jan Kuhlmann:
Messen, Steuern, Regeln im Kreislauf des Beitragswesens.
Beitragsdatenverarbeitung
Der große Plan: EDV-Kontrolle der Behandlungen
Prüfung der ärztlichen Leistungen
Die Hoffnungen
Selbstbedienung und Selbstbeteiligung
Messen, Steuern und Regeln in der Gesundheitsmaschine
Steuerung der medizinischen Weltsicht
Der medizinische Lebenslauf
1989 arbeitete ich als Programmierer bei einer
Krankenkasse. Es war das Jahr, nachdem das Gesundheitsreformgesetz verabscheidet worden
war. Für Fachleute hieß das Gesundheitsreformgesetz schon damals SGB V..
Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch. Darin sind Grundlagen der gesetzlichen
Krankenversicherung geregelt. Ein ganzes Kapitel: “Versicherungs- und Leistungsdaten.
Datenschutz” mit 21 Paragraphen behandelt die automatische Verarbeitung der
Informationen, die mit der Behandlung der krankenversicherten Menschen zu tun haben. Von
all dem, was die einundzwanzig Paragraphen vorschrieben und ermöglichten, war 1989 nichts
realisiert. Bis heute, 1995, ist nur ein Bruchteil davon verwirklicht. Ich bekam zusammen
mit Kolleginnen und Kollegen die Aufgabe, in einer Projektgruppe diese Umsetzung des
Zehnten Kapitels des SGB V. in die Wirklichkeit der Krankenkasse vorzubereiten.
Jedesmal, wenn ich diese §§ 284 bis 305 genauer
ansah, wurde mir schwindlig. Allein schon, wenn ich abzuschätzen versuchte, wie viel
Platz auf den Festplatten des Rechenzentrums für die Informationen gebraucht würde, die
die Krankenkasse bis jetzt noch jedes Quartal auf Zehntausenden von Krankenscheinen in
großen braunen Pappkartons bekam. Und was das kosten würde. Aber wenn es nur das gewesen
wäre. Programmierer haben wenig Illusionen über Datenschutz. Bei den Krankenkassen sind
auch die Gehälter aller Versicherten gespeichert, und in der EDV-Abteilung mußten
einfach einige wissen, wie man da herankam. Irgend jemand kam auch an die optimal
geschützten Informationen über die versicherten Beschäftigten unserer Kasse selbst und
konnte das Gehalt der Abteilungsleiter nachsehen. Nach dem neuen Gesetz sollten in diesem
offenen System auch die Diagnosen unserer Krankmeldungen, die an uns verübten
Behandlungen der Ärzte und die Arzneimittel stehen, die unsere Versicherten und wir
verschrieben bekommen.
Wenn es nur um den Zugang ginge, wäre das halb so
schlimm. In der Regel würde es mich und andere Programmierer wenig interessieren , ob
Sonja Walzmann aus Pirmasens im letzten Quartal ihre Schulter röntgen ließ, oder ob
Franz Hegewisch in Erlangen beim Masseur war. Unsere Programme würden dafür sorgen, daß
Facharzt und Masseur ihr Geld bekommen, und damit gut. Das Schwindelgefühl bei meiner
Arbeit kam auf, wenn ich daran dachte, daß Datenkreisläufe nicht nur das Mühlrad des
Bruttosozialproduktes antreiben, sondern auch benutzt werden zum Messen, Steuern und
Regeln der Lebenssituationen zahlloser nichtsahnender Menschen durch andere, die Macht
dazu haben.
An der Wand eines Gruppenleiters in der EDV unserer
Kasse hing damals ein Diagramm von der Größe zweier Plakate. Zahllose Pfeile zwischen
etwa 50 kleinen Kästchen markierten darauf den verschlungenen Weg von Informationen -
Datensätzen - durch viele Programme und Rechner. Stolz erklärte der Programmierer den
dargestellten Vorgang, der “Produktionskreislauf” hieß. Produktion im
Unterschied zu Test, es handelte sich um die “echten”, die
“Produktions”daten. “Kreislauf”, weil die Datensätze durch die
verschiedenen Rechner eine insgesamt kreisförmige Bewegung vollzogen und am Ende,
vielfach überprüft, gespeichert und statistisch verarbeitet, zu ihrem Ursprung
zurückkehrten.
In der bisherigen Krankenkassen-EDV geht es um
Beitragsdaten, um Informationen, die die Krankenkasse oder andere Sozialversicherungen
benötigen, um ihre Beiträge einzuziehen und ihre Mitglieder zu verwalten (Abbildung 1).
Eigentlich ist das harmlos, Sozialversicherung kostet nun mal Geld. Aber man kann die
Daten, die man eigentlich nur zum Kassieren braucht, per EDV auch zum Messen, Steuern und
Regeln einsetzen.
Ein paar Monate vorher mußte ich einmal alle
Geschäftsstellen der Krankenkasse nach Zahl der verwalteten Mitglieder und nach
Beitragseinnahmen pro Mitarbeiter absteigend sortieren. Am Ende der Liste sollten die
Geschäftsstellen stehen, die am wenigsten Beiträge einbrachten. Es kostete ein paar
Stunden, Daten aus der Mitglieder- und Beitragsverwaltung mit solchen aus dem
Personalwesen zu verbinden und die Liste zu erstellen. Die meiste Zeit war ich mit der
Erstellung schöner Balkendiagramme beschäftigt. Später sind die letzten acht
Geschäftsstellen meiner Liste geschlossen worden - das war der Sinn der Sache. Weitere
werden wahrscheinlich folgen (die Liste wird natürlich aktualisiert). In den
geschlossenen Geschäftsstellen betreute vorher je eine Mitarbeiterin ein paar hundert
Mitglieder. Die Betroffenen, auch Alte und Kranke ohne eigenes Auto, müssen jetzt zur
nächsten Geschäftsstelle, manchmal 50 km weiter weg, fahren. Natürlich war eine solche
Anwendung nicht in den Gesetzen vorgesehen, die die Erfassung und Verarbeitung der
Beitragsdaten regeln. Aber sie gehörte zu den ziemlich naheliegenden Dingen, die man mit
den Daten machen kann und darf. Als ich mich mit dem “elekronischen
Krankenschein” befassen mußte, habe ich mir überlegt, wie man die Informationen
über Arztbesuche der Versicherten zum Messen, Steuern, Regeln benutzen wird. Entsprechend
dem Programmierer-Motto: Was machbar ist, wird irgendwann einmal gemacht. Daher das
Schwindelgefühl. Ich fing an, genauer hinzuhören, wenn über Krankheit und soziale
Selektion oder über Gentests bei Einstellungen geredet wurde.
Datenverarbeiter lieben Validität und Konsistenz von Daten. Validität heißt, daß die gespeicherten Daten die Einheiten der “realen Welt” immer richtig bezeichnen. Jedesmal wenn z.B. jemand umzieht, muß durch ein festes Verfahren gesichert sein, daß die neue Anschrift dem Computer bekannt wird. Kein einziger Umzug darf lange unbemerkt bleiben. Konsistenz heißt, daß die Daten in sich widerspruchsfrei sind, und daß an mehreren Stellen gespeicherte Daten, die dasselbe bezeichnen (z.B. die Anschrift einer Person), immer gleich sein müssen. Validität und Konsistenz werden von deutschen Verwaltungen am liebsten durch einen geschlossenen Kreislauf von Übermittlungen gesichert, in den der betroffene Informationslieferant mittels Auskunftspflichen möglichst eng hineingeflochten wird.
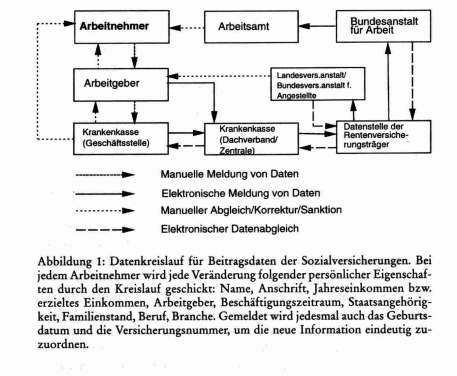
Dieser Kreislauf funktioniert schon seit 25 Jahren,
ohne daß man besonderen Grund zur Klage gehabt hätte. Das Schöne daran ist, daß die
Sozialversicherungen auf all das, worüber sie bisher in Computern Informationen
sammelten, so gut wie keinen Einfluß hatten. Sie konnten Arbeitgeber, Einkommen,
Staatsangehörigkeit oder Beruf der Menschen zwar messen, aber weder steuern noch regeln.
Man wäre erstaunt, wenn man wüßte, wieviele Tonnen Papier mit höchst detaillierten
Statistiken über die Versicherten jeden Monat ausgedruckt werden. Von allen
EDV-überwachten Größen konnten die Krankenversicherungen aber bisher nur ihre
Organisationen, ihre Erweiterungspläne und ihre Beitragssätze ändern. Sie mußten
bisher ihre Pläne an Entwicklungen in der Gesellschaft anpassen, statt umgekehrt.
Die Krankenversichertenkarte, die inzwischen
eingeführt wurde, ist ein kleiner Teil des großen EDV-Plans, der 1989 ins SGB V.
aufgenommen wurde. Sein Kernstück sind die
295-300 SBG V., die die Abrechnung ärztlicher
Leistungen und die Prüfung der Ärzte und Krankenhäuser regeln.
295 Abs. 2 schreibt vor, daß zukünftig die
Kassenärztlichen Vereinigungen Abrechnungen über sämtliche ärztlichen Leistungen an
die Kassen auf Wunsch auf Datenträgern liefern müssen. Gemäß
296 müssen die Kassenärztlichen Vereinigungen und
die Krankenkassen zusätzlich in jedem Quartal über jeden Behandlungsfall umfangreiche
Daten auf Datenträgern austauschen. Der Austausch läuft darauf hinaus, daß für beide
Seiten das gesamte Verhalten jedes einzelnen Arztes und jeder einzelnen Ärztin bis in die
Einzelheiten EDV-transparent gemacht wird. Nicht nur die vom Arzt abgerechneten Leistungen
und die Diagnosen, sondern auch seine Krankschreibungen, Verschreibungen von Arzneimitteln
und Heil- und Hilfsmitteln, die Überweisungen zu anderen Ärzten, die
Krankenhauseinweisungen und die angeordnete Krankengymnastik, Psychotherapie oder Massage
werden EDV-überprüft.
Gemäß § 297 werden darüber hinaus in jedem
Quartal für eine Stichprobe von 2 % der Ärzte diese Informationen arzt- und
patientenbezogen übermittelt. Insoweit ist das Arztgeheimnis aufgehoben. Wesentlicher
Zweck der Datenübermittlung ist die Kontrolle der Ärzte. Diese Kontrolle wird zukünftig
gemeinsam von Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen durchgeführt. Das
Verfahren dazu ist in § 106 SGB V. geregelt. Prüfungsmaßstäbe sind Durchschnittswerte
und Richtgrößen.
Auch heute schon werden die Abrechnungen der
Ärztinnen und Ärzte geprüft. Sie prüfen sich gegenseitig in ihrer Kassenärztlichen
Vereinigung. Das Gesamteinkommen aller Ärzte ist “gedeckelt”, es darf nicht
mehr steigen. Rechnen sie mehr ab, wird einfach der Stücklohn pro Leistung gekürzt. Der
Einzelne kann trotzdem mehr verdienen, wenn er auf Kosten seiner Kollegen viel mehr
Leistungen abrechnet. Damit nun kein wildes Wett-Abrechnen der Ärzte beginnt und die
Preise pro Leistung nicht ins Bodenlose fallen, haben die Ärzte die Selbstkontrolle
eingeführt. Schon dieser bisherigen Prüfpraxis liegt die Vorstellung zugrunde, daß es
für eine bestimmte Diagnose die optimale und wirtschaftlichste Behandlung gibt (Spiolek
1992, 212). Die Tätigkeit einer Ärztin gleicht nach dieser Vorstellung der eines guten
Ingenieurs, der an einer Maschine einen Schaden feststellt und die optimalen Maßnahmen
zur Behebung ergreift, wobei jede beliebige gut ausgebildete Kollegin jeden einzelnen
Handgriff genau so machen würde.
Diese im Gesetz vorgesehene Prüfung der ärztlichen
Leistungen nach Durchschnittswerten geht von der Hypothese aus, daß der Durchschnitt
aller Ärzte einer Fachrichtung in jedem Quartal zutreffenderweise immer die gleichen
Krankheiten bei den Patienten feststellt und diese entsprechend dem definierten
“optimalen” Stand der ärztlichen Kunst behandelt (Baader 1983: 3f; Ratajczak
1992: 247). Dadurch muß es bei allen Ärzten einer Fachgruppe immer zum gleichen
Leistungsspektrum kommen: hinsichtlich der Aufteilung der Leistungen z.B. in technische
und nicht technische Leistungen, hinsichtlich der Summe der Einnahmen pro Krankenschein,
sogar hinsichtlich jeder einzelnen Ziffer der Gebührenordnung für Ärzte (Ratajczak
1992: 246). Wenn die Ärztin von der durchschnittlichen Punktzahl pro Schein, dem
“Scheinschnitt”, um bis zu 20 % nach oben abweicht, wird das hingenommen als
normale Streuung beim “Patientengut”. Bei einer Abweichung nach oben zwischen 20
% und 50 % wird eine Einzelfallprüfung vorgenommen, bei der einzelne Behandlungen
mit dem “Stand der Kunst” verglichen werden. Bei Verstößen dagegen werden
Kürzungen verhängt. Liegt die Abweichung über 50 %, ist eine solche Einzelfallprüfung
nicht mehr nötig für den Vorwurf des unwirtschaftlichen Verhaltens. Das Honorar wird
automatisch gekürzt. Bei einzelnen Gebührenziffern setzen die Überprüfungen bei 50 %
Überschreitung ein, die automatischen Kürzungen bei 100 % (Brüggemann/Mader 1990: 174).
Dem medizinischen Laien muß dieses System geradezu
absurd erscheinen. Das Verhältnis zwischen Ärztin und Patientin ist ein Verhältnis
zwischen Menschen, und dieses Verhältnis entzieht sich jeglicher Standardisierung und
Normierung. Die Kontrollen bewirken, daß die Ärzte die Patienten nicht mehr als
Individuen, sondern als Instanzen der Klasse Patient sehen, die in die statistisch am
besten passende Schublade einsortiert werden müssen. Die logische Unstimmigkeit dieses
Systems zeigt sich z.B. daran, daß zwar die Ärztinnen, die mehr Leistungen abrechnen als
der Durchschnitt, bestraft werden, weil der Durchschnitt den “Stand der Kunst”
repräsentiert; daß aber den Ärztinnen, die wesentlich weniger abrechnen, nichts
geschieht, auch wenn sie nach unten noch weiter vom “Stand der Kunst” abweichen.
Nach dem Gesetz sollen die Behandlungen von
Allgemeinärztinnen bald nach “Fallkomplexpauschalen” bezahlt werden, deren
Höhe sich nach der Schwere der festgestellten Krankheit richtet. Wenn der Arzt eine
bestimmte Krankheit feststellt, soll er künftig zur Behandlung einen festen Betrag als
Honorar für sich selbst und einen weiteren Betrag für Medikamente, Heil- und Hilfsmittel
bekommen. Dasselbe System wird im Krankenhaus eingeführt (§ 87 Abs. 2a SGB V., § 17
Abs. 2a Krankenhausfinanzierungsgesetz). Das Prinzip des Kontrollsystems für
Einzelleistungen wird zur Zeit in Projekten auf die Diagnose-Pauschalen der Krankenhäuser
übertragen. Die festgestellten Krankheiten werden damit ähnlich kontingentiert und
standardisiert, wie jetzt die Behandlungen. So, wie die Ärztinnen jetzt in jedem Quartal
einen Vorrat an Tätigkeiten und Medikamenten unter den Patienten aufteilen, werden sie
zukünftig einen Vorrat an Krankheiten zuweisen müssen. Kein Arzt darf dann in einem
Quartal mehr Allergien als Schnupfen feststellen.
Bei der Verschreibung von Arzneimitteln können statt
Durchschnittswerten auch Richtgrößen zur Prüfung herangezogen werden, die zwischen
Ärzten und Kassen ausgehandelt werden. Auch alle anderen ärztlichen Tätigkeiten
(Krankschreibungen, Krankenhauseinweisungen usw.) sollen nach
106 SGB V. an Durchschnittswerten gemessen werden.
Das System läuft darauf hinaus, daß der Arzt in jedem Quartal ein begrenztes Kontingent
an Geld für Medikamente, an Krankschreibe-Tagen und Überweisungen in Krankenhäuser zur
Verfügung bekommt. Die Höhe des Kontingentes bemißt sich nach dem Durchschnitt ihrer
Kollegen oder nach politisch verordneten Richtwerten. Nur diese feste Menge darf unter den
Patienten aufgeteilt werden. Gesundheitsleistungen werden rationiert, möglichst, ohne
daß die Patienten es bemerken.
Nach aktuellen Planungen der Ortskrankenkassen und
des Bundesministeriums für Gesundheit soll die Kontrolle aber viel weiter hinunter gehen.
Bis jetzt wird nur statistisch geprüft, ob das gesamte Abrechnungsverhalten eines Arztes
auffällig ist oder nicht. Nur bei Auffälligkeiten prüft man die einzelnen Behandlungen.
In Zukunft soll jeder einzelne Behandlungsfall, auch über längere Zeit als ein Quartal,
darauf überprüft werden. ob Diagnose und Therapie “plausibel” sind.
Wissenschaftler sind schon dabei, im Auftrag der Verbände Profile für
“richtige” Behandlungen zu bilden. Warum auch nicht, könnte man denken. Bei der
Diagnose Lungenentzündung darf ein Arzt keine Massage verschreiben, aber Antibiotika. Bei
Verstauchung darf es keine Beruhigungspillen geben, aber einen Verband und eine
Röntgenaufnahme. Das kann per Computer geprüft werden.
Bei jedem einzelnen Patienten soll der Arzt in
Zukunft nicht nur daran denken, was seiner Meinung nach dem Patienten fehlt, und was
dieser haben will. Wenn er eine Massage verschreiben will, muß er überlegen: “Habe
ich noch Geld für Massagen übrig?” “Brauche ich diese Massagen für andere
Patienten dringender als für diesen?” “Welche Krankheit müßte ich
feststellen, um eine Massage zu rechtfertigen?” “Darf ich diese Krankheit noch
feststellen, oder habe ich davon schon zu viele in diesem Quartal?” “Welche
Medikamente darf ich bei dieser Diagnose verschreiben, welche nicht?” Die Papierform
muß stimmen, bei jedem einzelnen Patienten. Die Ärzte werden damit genötigt, sich mehr
und mehr als Verwaltungsbeamte der Ärzteverbände und Krankenkassen zu verhalten.
Kernstück dieses Projektes war die Ausstattung aller
Versicherten (ca. 85 % der Bevölkerung) mit einer Krankenversichertenkarte, auf der
persönliche Daten in einem Microchip gespeichert sind, insbesondere Name, Anschrift, die
Krankenkasse und die Versichertennummer. Die Ärzte wurden auf Kosten der Versicherten
durchgängig mit Geräten ausgestattet, in denen die Karten gelesen werden können. In der
einzelnen Arztpraxis werden die Abrechnungsscheine (früher: Krankenscheine), die Rezepte
und Krankmeldungen automatisch mit den Versichertendaten bedruckt. Die Arztnummer, das
Behandlungsdatum, der Befund, die vom Arzt abgerechneten Leistungen werden maschinenlesbar
hinzugefügt. Der Abrechnungsbeleg (oder ein entsprechender Datensatz) wird an die
Kassenärztliche Vereinigung weitergeleitet. Dort werden die Informationen automatisch
gelesen und ausgewertet. Die Kassenärztlichen Vereinigungen reichen die Daten seit 1994
per Datenträger an die Landesverbände der Krankenkassen weiter. Die Kassen speichern die
Informationen in Rechnern, um die Ärzte zu überprüfen.
Das in der Praxis ausgedruckte maschinenlesbare
Rezept muß der Versicherte bei der Apotheke einreichen. Dort wird zu jedem verschriebenen
Medikament noch die Pharmazentralnummer erfaßt und auf das Rezept gedruckt. Auf diesem
Rezept stehen jetzt Kennzeichen des Versicherten, seiner Krankenkasse, des Arztes, der
Apotheke, der Medikamente, sowie die Preise - alles maschinenlesbar. Das Rezept wird von
einem Lesegerät erfaßt, als Datensatz an ein Apotheken-Rechenzentrum weiter geleitet und
von dort an die Krankenkasse. Dort wird es im Großrechner gespeichert. Das gleiche gilt
von allen anderen Rezepten, z.B. für Brillen, Rollstühle, Verbände. Bei den
Krankenkassen sollen alle Leistungen, die ein Arzt verordnet hat, zusammengeführt und an
die Kassenärztliche Vereinigung gemeldet werden. So ermittelt man die Ärzte, die ihr
zugeteiltes Kontingent überschritten und mehr verordnet haben, als sie durften.
Muß man ins Krankenhaus, ist man einer besonders
intensiven Datenabschöpfung der Krankenkasse ausgesetzt. Alle Behandlungsinformationen,
die das Krankenhaus hat und die sich irgendwie standardisieren lassen - insgesamt mehr als
30 verschiedene Datenfelder - müssen an die Krankenkassen weiter geleitet werden.
Natürlich maschinell lesbar und damit für die Computerkontrolle aufbereitet. Da man in
Deutschland gründlich arbeitet, wurde auch die Krankschreibung nicht übersehen. Auch sie
wird vom Arzt maschinenlesbar ausgedruckt, einschließlich des digitalen
Nummernschlüssels für die Krankheit auf dem Abschnitt für die Krankenkasse.
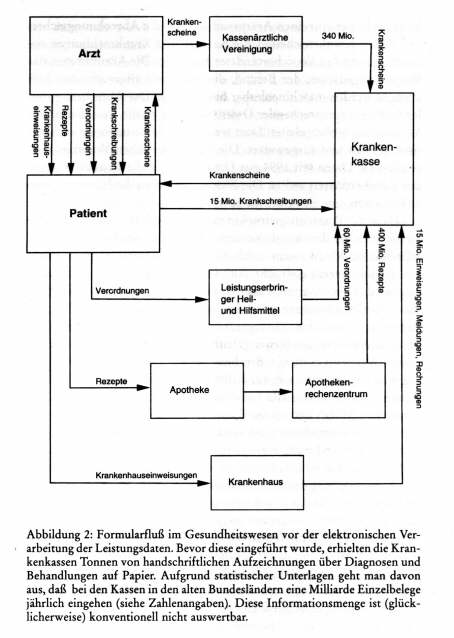
Wie diese riesigen Datenmengen (siehe Abbildung 2)
übermittelt und verarbeitet werden sollen, ist bis Redaktionsschluß dieses Buches, Mai
1995, nicht endgültig geklärt. Kassen und Ärzteverbände müssen die Einzelheiten durch
Vertrag regeln. Von den vorgesehenen neun Abschnitten des “Vertrags über den
Datenaustausch mit Datenträgern” sind erst vier vereinbart worden. Daß auch sie
wieder geändert werden, steht schon fest.
Die Angestellten-Krankenkassen wollen die private
Firma debis, die EDV-Tochter des Daimler-Benz-Konzerns, zur Schaltzentrale für
Gesundheitsdaten machen. Die Ärztekammern, Krankenhäuser und Apotheken sollen alle
Behandlungs-Informationen an debis liefern. Dort sollen sie nach Krankenkassen aufgeteilt
und an die Krankenkassen übermittelt werden. Es wäre der logisch nächste Schritt, daß
debis die Daten nicht nur verteilt. Eine Krankenkasse allein hat gar nicht genug
Informationen, um das “Leistungsverhalten” eines Arztes statistisch so zu
untersuchen, wie es die Kassenärztliche Vereinigung kann. Jede Kasse hat nur
Behandlungsinformationen über ihre Versicherten. Nur eine Zentralstelle könnte, um einen
Arzt zu überprüfen, gleichzeitig auf die Daten aller verschiedenen Angestellten-Kassen
zurückgreifen. Debis könnte diese Funktion übernehmen.
Die Konkurrenz, die Orts-, Betriebs- und
Innungskassen (sog. Primärkassen), ist nicht untätig. In einem Modellversuch in Bayern
wollen die Primärkassen, gemeinsam mit dem Bundesministerium für Gesundheit, diese
“Kassenübergreifende Auswertung” der Krankheitsdaten erproben. Krankenhäuser,
Apotheken und Ärzteverbände sollen einer einzigen Zentralstelle die Behandlungsdaten
aller Versicherten liefern. Dort sollen die Daten durchgeprüft werden. Ein solches
Gesundheits-BKA ist zwar im Gesetz nicht vorgesehen, aber das Seehofer-Ministerium
fördert es und wird eventuell notwendige Änderungen des Gesetzes rechtzeitig
veranlassen.
Die Bekannten, denen ich von den Verdatungs- und
Kontrollplänen erzählte, verstanden meine Bedenken nicht. Die Skepsis wegen der
Speicherung von Informationen über ihre Krankheiten und Krankschreibungen teilten sie.
Aber daß man den Ärzten endlich mal auf die Finger sehen müsse, sei doch klar.
Noch größer war meine Verwunderung, als ich mit
kritischen Fachleuten aus den Krankenkassen sprach. Es muß doch endlich etwas geschehen,
war der Tenor. Daß man das Gedröhn um die “Kostenlawine im Gesundheitswesen”
in Frage stellte, war Ehrensache. In diesem Milieu kennt man die Zahlen und die Fakten.
(Siehe dazu Seite _). Aber daß sich die Ärzte mit sinnloser Apparatemedizin zügellos
bereichern, daß sie unsinnige Arzneimittel verschreiben und man dem nur mit scharfen
Kontrollen beikommen kann, war allgemeine Meinung. Die Frage, wer denn kontrollieren, was
der Kontrollmaßstab sein solle, löste nur Achselzucken aus. Wer kontrollieren solle?
“Na, am besten wir! Hauptsache, den Ärzten wird endlich auf die Finger
geklopft.”
Eine Vokabel kam immer wieder vor: Selbstbedienung
der Ärzte. (Siehe S. _). Die einzelnen Ärzte werden nach Einzelleistungen bezahlt. Sie
können also ihr Einkommen dadurch steigern, daß sie den Patienten mehr oder aufwendigere
Behandlungen “verkaufen”. Solange dieses Entgeltsystem besteht, scheint es, als
sei eine schärfere Kontrolle der Ärzte notwendig. Die Kontrolle setzt aber voraus, daß
jemand besser als Arzt und Patient weiß, wie man einen Menschen und seine Krankheit
richtig behandelt.
Auch in den ehemaligen sozialistischen Staaten haben
die Institutionen sich selbst vorgestellt als wissenschaftlich gebildete, allwissende
Überväter, die den Bürgerinnen und Bürgern soziale Leistungen gerecht und
gleichmäßig zuteilen können, weil sie bis ins Detail über sie informiert sind.
Dasselbe Konzept, nämlich Eigennutz und Eigenwilligkeit der Menschen durch dichte und
unausweichliche Kontrollen zu bekämpfen, steht hinter den Plänen zur EDV-Kontrolle der
Ärzte. Gesichtspunkte der “Wirtschaftlichkeit” und des Marktes werden mehr und
mehr zur Leitlinie dieser Kontrollen (Kühn 1991). Wir sind auf dem Weg, die Nachteile des
Sozialismus mit denen des Kapitalismus zu vereinigen.
Das “Institut der deutschen Wirtschaft”
bezifferte die Netto-Jahreseinkommen niedergelassener Ärzte bei Laborärzten auf
692.000 DM, bei Orthopäden auf 323.000, Urologen 211.000, Allgemeinärzten 143.000,
Kinderärzten 132.000 DM. Das ist bei den Allgemeinärzten soviel, wie ein Bundeskanzler
nach Hause trägt, bei den anderen erheblich mehr. Des öfteren kommen Fachleute auf die
Idee, daß hier enorme Möglichkeiten der Kostensenkung stecken (Welzk (1995): 142).
Gesundheitsökonomen sprechen davon, daß bei den
Ärzten Bedarfswecker und Bedarfsdecker identisch seien. Also: Die Ärzte sagen den
Patienten, welche Behandlung ihnen fehlt, und bieten sie ihnen an. Die Patienten
akzeptieren das Angebot, das ihnen der Arzt als “gesundheitsnotwendig”
darstellt. Bei uns kostet das die Patienten erst einmal nichts (das ist das
Sachleistungsprinzip). Das Beispiel der USA zeigt, daß die Patienten den Ärzten auch
dann glauben, wenn sie die bestellte Behandlung gleich selbst bezahlen müssen. Sofern sie
es sich irgendwie leisten können. Dort wird pro Kopf noch viel mehr für
Gesundheitsleistungen ausgegeben als bei uns. Selbstbeteiligung der Versicherten änderte
am Verbrauch von Gesundheitsleistungen in den hochentwickelten Industrieländern nichts.
Sie bewirkt nur eine unsoziale Verteilung der Belastung (siehe Seite _).
Solange am Prinzip der Einzelleistungs-Vergütung
nichts geändert wird, werden die Einkommen der Ärzte nicht sinken. Da diese das wissen,
halten sie an dem Prinzip fest. Wenn man Kosten sparen will, ohne Rationierung und
Standardisierung von Gesundheitsleistungen, ohne 3-Klassen-Medizin, müßte das
Bezahlungssystem geändert werden. Man müßte sich allerdings möglicherweise auf einen
Ärztestreik, einen politischen Krieg eines ganzen Wirtschaftszweiges gefaßt machen.
Ärzte gehören in Deutschland zu den
Großverdienern. Oben in Kapitel 3 haben wir gezeigt: Gespräche mit den Patienten bringen
ihnen so gut wie nichts ein, es sei denn, sie stufen die Patienten gleich als
psychiatrische oder psychosomatische Fälle ein. Auch eine gutwillige und materiell
anspruchslose Allgemeinmedizinerin hat deshalb nur zwei Möglichkeiten, nicht pleite zu
machen: entweder sie erbringt technische Leistungen, von der Blutabnahme über die Spritze
bis zum Röntgenbild, die sie selbst für unnötig hält. Damit deckt sie die Verluste,
die sie durch Gespräche macht. Oder sie rechnet Leistungen ab, die sie nicht erbracht
hat. Die materiell anspruchslosen Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, tun ein wenig von
beidem. Da kann man sich ausrechnen, wie die materiell anspruchsvollen Ärzte abrechnen.
Solange die Kontrolle der Abrechnungen nur über die
“Scheinschnitte” funktioniert, kann das gut gehen. Denn den Einblick in die
Einzelleistungen haben nur die Kassenärztlichen Vereinigungen. Die aber haben keinerlei
Interesse, die vielen Tricks der Ärzte aufzudecken, die sogar in Seminaren vom
Hartmannbund gelehrt werden. Viele Ärzte haben schon ein Praxis-EDV-System mit einer
Ärzte-Software, die von der Kassenärztlichen Vereinigung anerkannt ist. Bestandteil
jedes dieser Programme ist, daß der Anwender jederzeit feststellen kann, wie weit er mit
ihren Behandlungen im Quartal noch vom Durchschnitt der Ärzte seiner Fachrichtung und von
der eigenen Abrechnungsleistung im letzten Quartal entfernt ist. Damit wird der Arzt
darauf orientiert, pro Krankenschein ein wenig mehr als den Durchschnitt abzurechnen. Die
Kostensteigerungen werden dadurch für die Kassen nicht greifbar, sie lassen sich nicht
auf den einzelnen Arzt zurückführen.
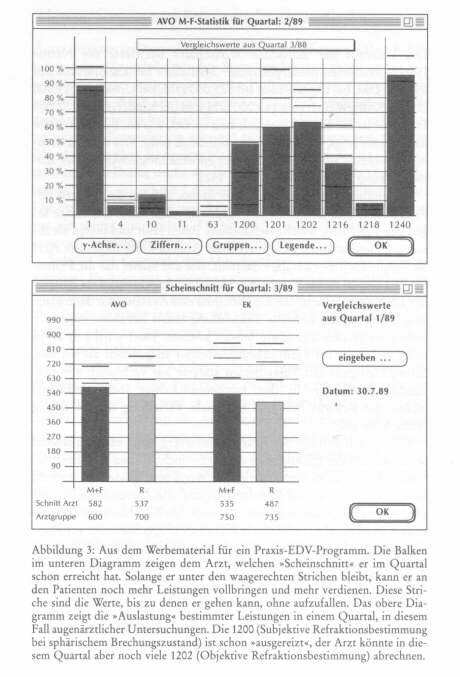
Wenn aber jetzt die Krankenkassen in die Einzelheiten
des “Leistungsgeschehens” hineinsehen können, werden eine Vielzahl von
Plausibilitätsprüfungen möglich. Stimmt der Durchschnitt der Diagnosen? (Nicht alle
Patienten können eine sehr schlimme Krankheit haben). Stimmt der Zusammenhang zwischen
Diagnose und Leistung? (Bei einem Schnupfen kann man keine Blutabnahme machen). Stimmt das
Verhältnis zwischen Leistungszeit und Arbeitszeit (ein Arzt kann nicht 100 besonders
gründliche Untersuchungen am selben Tag durchführen). Und in den Stichprobenprüfungen
können die Kassen sogar direkt die Patienten fragen, was der Arzt getan hat.
Den einzelnen Ärzten bleiben nur Ausweichstrategien.
Man kann ehrlich sein und bei normalen Infektionen nur eine einfache Untersuchung und
Beratung aufschreiben. Dann muß der Patient nach drei bis vier Minuten das
Behandlungszimmer verlassen. Also: Griff zum Rezeptblock, Billig-Arzneimittel, der
nächste bitte. Oder man kann öfter als bisher etwas wirklich Schlimmes bei Patienten
finden, etwas, das eine intensive Behandlung erfordert. Diese intensive Behandlung führt
man dann auch wirklich durch. Am besten, man kombiniert beide Methoden, dann stimmt die
Statistik über alle Patienten.
Bisher haben die Ärzte auch ein bißchen die
Patienten betrogen. Wenn sie sich ausführlicher mit uns unterhalten hatten, schrieben sie
zum Ausgleich ein paar teure Gebührenziffern und eine entsprechend schlimme Diagnose. Wir
wußten zum Glück nichts von unserem Siechtum. Wenn aber die Kassen auch die
Apothekenrezepte, Röntgenleistungen usw. in die Kontrolle einbeziehen, geht das nicht
mehr. Dann werden wir den Verdacht des Arztes auf Magengeschwür oder auf einen kleinen
Gehirntumor, der bei schlimmen Magen- oder Kopfschmerzen ja aufkommen kann, bitter ernst
nehmen müssen. Er wird uns nicht sagen, daß er diese Diagnose gerade braucht, um in
diesem Quartal seinen Schnitt zu machen. Das gleiche gilt für schwerwiegende
psychiatrische und psychotherapeutische Diagnosen, z.B. “psychische
Dekompensation”. Die dazugehörigen Behandlungen sind inzwischen mit ähnlich hohen
Punktwerten ausgestattet wie technische Leistungen. Ihre Nutzung wird
“ganzheitlichen” und anderen Ärzten dringend empfohlen, damit sie rentabel
arbeiten (Machens (1994): 127; Brüggemann/Mader (1990): 127-130). Die Kontrolle der
Ärzte erzwingt, daß sie demnächst nach den Möglichkeiten der Gebührenordnung nicht
nur aufschreiben, sondern auch Krankheiten feststellen und behandelt werden. Und wir, die
Patientinnen und Patienten, werden mitmachen. Was bleibt uns übrig, als den Fachleuten zu
vertrauen. Wir müssen uns damit abfinden, daß wir nach einer Medizinalordnung kuriert
werden, und daß bei uns die Krankheiten auftreten, die dort stehen.
Durch die Art der Abrechnung wird auch bestimmt, wie
medizinische Leistungen unter den Patienten aufgeteilt werden. Budgets für Arzneien und
Hilfsmittel haben ebenso ihre Auswirkungen, wie Diagnose-Pauschalen. Die Tendenz der
Budget-Kontrollen richtet sich gegen die Alten und Kranken. Denn je jünger und gesünder
die Patienten sind, desto weniger Hilfsmittel und Medikamente verlangen sie vom Arzt,
desto geringer wird dessen Risiko, sein Konto für Medikamente und Hilfsmittel zu
überziehen. Mit vielen alten oder behinderten Patienten hängt der Arzt schnell in den
Maschen der Kontrolle. Es ist seit dem Gesundheitsstrukturgesetz 1993 im finanziellen
Interesse der Ärzte, jüngere und gesündere Patienten zu behalten, und überzählige
Alte und chronisch Kranke zur Konkurrenz abzuschieben. Der ideale Patient, die ideale
Patientin ist mittelkrank. Weder ganz gesund (daran verdient man nichts), noch behindert
oder chronisch krank (zu hoher Ressourcenverbrauch, Gefahr des Honorarabzugs.) Der
Normalmensch hat eine Normkrankheit.
Für die Allgemeinmediziner und Praktischen Ärzte
soll es in Zukunft eine “Leistungskomplexpauschale” pro Patient und Quartal
geben, deren Höhe sich nach der Schwere der Krankheit richten soll. Damit werden Ärzte
noch mehr Menschen, die kaum zu klagen haben, für ziemlich krank erklären müssen, aber
die, denen es sehr schlecht geht, werden oft gesünder sein, als sie denken. Wir werden
gesunde Kranke, und kranke Gesunde. Denn je schlimmer die Krankheit ist, die die Ärzte
bei mir feststellen, desto mehr Geld der Kasse dürfen sie für mich ausgeben, desto mehr
verdienen sie selbst. Die Festbeträge richten sich aber nach Durchschnittspatienten. Bei
derselben Krankheit ist die Behandlung von Jungen und Gesunden einfacher und billiger. Die
Heilung von Alten, chronisch Kranken oder Behinderten ist viel teurer, sie verbrauchen
mehr Arbeitszeit, Mittel und Medikamente, als ihre Pauschalen hergeben. Sie sind für die
Krankenhäuser schon heute eine Belastung. Auch für die Ärzte werden sie es bald sein.
Bei ihnen ist es ökonomisch ungünstig, neue Krankheiten zu erkennen, denn man müßte
sie mit Verlust behandeln. Da sieht der Arzt lieber nicht so genau hin.
Die Fachärzte sollen weiterhin
Einzelleistungs-Vergütungen erhalten. Im Interesse der Transparenz, die von den Kassen
angestrebt wird, müßte es dort bei der harten Medizin bleiben. Also bei der Körperteil-
und Organreparatur nach Zeitvorgaben, denn nur eine solche Behandlungsweise ist mit dem
neuen System prüfbar. Eine sanfte Medizin entzieht sich der Kontrolle. Bei ihr ist einem
bestimmten äußerlichen Symptom nicht eine ganz bestimmte, mit bestimmten Mitteln
ausgeführte Diagnose und Therapie zugeordnet. Wenn die sanfte Medizin sich bei
Fachärzten durchsetzten würde, wären die Kontrollinvestitionen der Kassen sinnlos. Doch
die Kassen werden es uns nicht leicht machen. Sie werden mit ihren Kontrollen sanfte
Behandlungsweisen noch unrentabler machen, als sie schon sind.
Für die Fachärzte läuft es deshalb darauf hinaus,
ihre Behandlungsweise einzufrieren. Das Verständnis von ärztlicher Kunst, das dem
“einheitlichen Bewertungsmaßstab” zugrunde liegt, nämlich die Organ- und
Körperteilreparatur nach Zeitvorgaben, wird unveränderbar festgeschrieben. Auch die
jetzige Verteilung der Krankheiten und Behandlungen auf die Gesamtheit der Patienten wird
zunächst eingefroren, dann planmäßig beschränkt. Wir bekommen eine Standardmedizin mit
Standarddiagnosen und Standardtherapien. Ob es uns persönlich besser oder schlechter geht
als der Standard vorsieht, ist unwichtig. Wer anders behandelt werden will, muß sich
privat versichern.
Ärztevertretungen fordern bereits seit langer Zeit,
daß die gesetzliche Krankenversicherung nur die sogenannte Grundsicherung abdecken solle.
Alles, was darüber hinaus gehe, sollten die Patienten selbst zahlen (und könnten dafür
eine private Zusatzversicherung abschließen). Beim Zahnersatz wurde schon ein erster
Schritt in diese Richtung gemacht.
Die Aufspaltung in Grund- und Zusatzsicherung kann
nicht nur dadurch geschehen, daß bestimmte ärztliche Leistungen ausdrücklich aus dem
Leistungskatalog herausgenommen werden. Möglich ist auch, daß die Kassen und
Ärztevereinigungen eine ärztliche Behandlungsweise, die uns Patienten angemessen
erscheint, durch ihre Kontrollen unmöglich machen. Wenn die Kontrollen wirklich greifen
und die Ärzte dadurch zur Minimal-Medizin gezwungen werden, wächst der Anreiz, dieses
System mit einer privaten (Zusatz-)Krankenversicherung hinter sich zu lassen - natürlich
nur für die, die es sich leisten können. Die Grundversorgung der etwas Ärmeren, die
noch von den Kassen bezahlt wird, könnte dann um so rigider kontrolliert werden.
Grundlagen dieser Kontrolle liegen schon bereit: Theorien darüber, wessen Gesundheit und
Leben zuerst geopfert werden muß, wenn das Geld knapp wird.
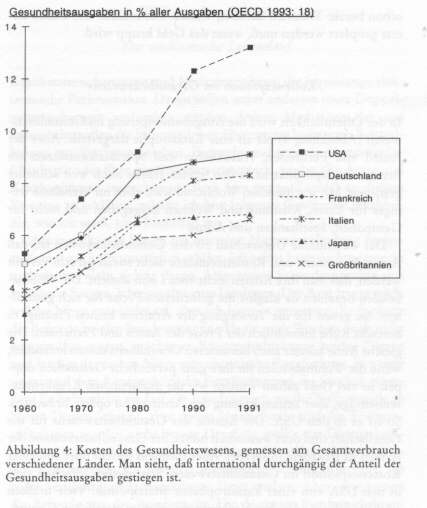
In der Öffentlichkeit wird die Ausgabensteigerung im
Gesundheitswesen (Abbildung 4) oft als eine Katastrophe dargestellt. Aber der Anteil von
Fernreisen, Autokäufen und Spielbankumsätzen am BruttoInlandsprodukt ist in den letzten
Jahren noch weit massiver gestiegen. Mit wachsendem Wohlstand wird eben im Verhältnis
weniger für Essen, Kleidung und Wohnen ausgegeben und mehr für Gesundheit, Spielbanken
und Autos.
Der wesentliche Unterschied bei den Gesundheitskosten
ist, daß Autos, Fernreisen und Rouletteeinsätze nicht sozial gerecht verteilt werden,
daß man ihre Kosten nicht vom Lohn abzieht. Die Wohlhabenden bezahlen da klaglos die
geforderten Preise für sich ganz allein. Sie geben für die Versorgung der Ärmeren
keinen Pfennig, es herrscht Ruhe hinsichtlich der Preise der Autos und Fernreisen. Die
gleiche Ruhe könnte auch bei unseren Gesundheitskosten herrschen, wenn die Wohlhabenden
für ihre ganz persönliche Gesundheit doppelt so viel Geld zahlen würden wie die
momentanen Krankenkassenbeiträge, aber keinen Pfennig den Ärmeren zu opfern bräuchten.
So ist es in den USA. Die Kosten des Gesundheitswesens für die Gesellschaft sind dort
doppelt so hoch, der Gesundheitszustand der Armen ist trotzdem miserabel. Aber niemand
spricht dort von einer Kostenexplosion im Gesundheitswesen. Statt dessen sprechen viele in
den USA von einer katastrophalen Sozialpolitik. Viele verarmte Weiße mußten erleben,
daß sie oder ihre Nachbarn mit 50 vom staatlichen Gesundheitssystem fallengelassen
wurden, daß behinderte Kinder sterben mußten. Die staatliche Krankenversicherung war ein
Hauptthema des Wahlkampfes von Bill Clinton, er versprach Besserung für deren Finanzen.
Aber wir hinken ja immer 10 Jahre hinter den USA her.
Krankenversicherungen und Mediziner planen die
lebenslange elektronische Patienten-Akte. Damit sollen, unter anderem, teure
Doppeluntersuchungen verhindert werden. Jedem Mediziner, der uns untersucht, sollen die
Informationen über unsere bisherigen Behandlungen zur Verfügung stehen. Entweder auf
unserer Gesundheits-Chipkarte, oder über ein Computer-Netzwerk, an das alle Ärzte und
Krankenhäuser angeschlossen sind. Um meine Zweifel an diesem Konzept zu erklären,
hmöchte ich hier folgende Geschichte erzählen, die, wie ich weiß, kein Einzelfall ist:
Militärmediziner hatten bei mir eine
Nierenentzündung festgestellt und mich für untauglich erklärt. Ich selbst hatte nichts
gemerkt und glaubte nicht richtig daran. Aber meine Freundin machte sich ernsthafte
Sorgen, ich ging zum Urologen. Der Arzt fragte mich, welche Niere entzündet war, aber ich
hatte es vergessen. Er forderte die Befunde bei der Bundeswehr an. Aber als sie wochenlang
nicht kamen, machte er Röntgenaufnahmen beider Nieren und fand in der linken Niere eine
chronische Entzündung. Er zeigte sie mir auf dem Röntgenbild, die Entzündung sei da,
deutlich zu sehen. Er behandelte sie fast ein Jahr lang, ich mußte Sulfonamide in hohen
Dosen nehmen, aber meine Urin-Befunde und die Röntgenaufnahmen wurden nicht besser. Der
Arzt wollte zur Chemotherapie mit Cortison übergehen, oder mich zwecks “offener
Nieren-Biopsie” aufschneiden, ich weigerte mich. Meine Freundin meinte, ich sollte
vernünftig sein, man könnte daran sterben. Aber jetzt kamen die Befunde von der
Bundeswehr. Die Ärzte im Bundeswehrkrankenhaus hatten die Entzündung ganz eindeutig in
der rechten Niere erkannt. Die Aufnahmen lagen bei, und die Entzündung in der rechten
Niere war mit Filzstift eingekreist. Ansonsten waren die Bilder identisch mit denen von
meinem Arzt. Danach bin ich einfach nicht mehr hingegangen; das ganze ist 20 Jahre her.
Inzwischen weiß ich aus Erfahrung: ich könnte mir
jederzeit wieder beim Urologen eine Nierenentzündung abholen, auf jeder gewünschten
Niere, ich brauche nur leichte Rückenschmerzen rechts oder links zu haben. Der Urologe
würde die Entzündung auf dem Röntgenbild sofort sehen: wegen des Urin-Befundes muß sie
einfach da sein. Ich könnte dann solange Cortison schlucken, bis wirklich eine Niere
kaputt ist. Wenn es damals einen Ort gegeben hätte, wo man meine medizinischen Daten
hätte abrufen können, wäre ich um diese Erfahrung ärmer. Jeder Urologe hätte zuerst
in den Computer geschaut und geprüft, was seine Kollegen gesehen haben. Und dann hätte
er das gleiche gesehen. Da wäre ich machtlos gewesen und hätte Cortison eingenommen. Und
hätte wahrscheinlich keine Chance mehr gehabt, manche Einstellungsuntersuchungen zu
überstehen. Mein Leben wäre gründlich anders verlaufen.
Viele Patienten lassen wichtige medizinische
Feststellungen noch einmal von einem zweiten Arzt gegenchecken, ohne ihm von der ersten
Untersuchung zu berichten. Solche Doppel-Untersuchungen sollten möglich sein. Niemand
soll wissen, ob es überhaupt, und wo es medizinische Informationen über uns gibt, es sei
denn, wir wünschen es. Daß es eine allgemein bekannte Stelle gibt, bei der
Gesundheitsdaten gespeichert sind, verletzt schon unser Selbstbestimmungsrecht. Bisher
konnte jeder Versicherte unwiderlegbar behaupten, er sei nicht in ärztlicher Behandlung.
Man muß häufig bei der Einstellungsuntersuchung den eigenen Arzt von der Schweigepflicht
gegenüber dem Betriebsarzt entbinden. Aber man kann seinen Arzt veranlassen, nur
bestimmte Informationen weiterzugeben, kann gar keine oder nur bestimmte Behandler angeben
und andere verschweigen. Zukünftig könnten Arbeitgeber die Einstellung davon abhängig
machen, daß man die “Selbstauskunft” der Krankenkasse über seine gespeicherten
Gesundheitsdaten vorlegt. Auf diese Selbstauskunft hat jeder einen gesetzlichen Anspruch.
Der Auszug aus dem Gesundheitsregister könnte in Zukunft eine ähnliche Rolle spielen,
wie die Schufa-Auskunft (Kuhlmann 1993: 205).
Aber die Gesundheitsökonomen sehen ein “hohes
Sparpotential”, wenn man alle Doppel-Untersuchungen unterbinden würde. Noch mehr
könnte man nach ihrer Ansicht sparen, wenn alle Menschen ihre Gesundheitsrisiken kennen
und gesundheitsbewußt leben würden. Auch dazu soll die elektronische Krankenakte dienen.
“Wer Risiken vermeidet, bleibt gesünder”, so heißt es. Die Anleitung des
Lebens durch Medizin wird in den Alltag verlängert, jeder wird dadurch ununterbrochen
Patient.
Früher gab es eine Sorte Gesunde und viele Arten von
Kranken. Man war gesund, wenn man nicht zum Arzt ging. Zukünftig gibt es keine Gesunden
mehr. “Risikoträger des Risikos X” ist eine neue Art der Diagnose. Bei jeder
Behandlung muß der Arzt unsere Krankheit in ein Schlüsselverzeichnis einordnen, die
“Internationale Klassifikation der Krankheiten” (International Classification of
Diseases, ICD). Darin ist jeder Krankheit eine Nummer zugeordnet. In der Klassifikation,
in die wir zur Zeit eingeordnet werden, nämlich der neunten Revision der ICD, sind
bereits viele Bereiche mit “Risiko-Diagnosen” enthalten: Gutartige Neubildungen
(210 - 229 ), Persönlichkeitsstörungen (301), Sexuelle Verhaltensabweichungen und
Störungen (302), wozu auch Homosexualität gehört (Ziffer 302.0), Alkoholabhängigkeit
(303) - Alkoholkrankheit ist eine andere Ziffer -, und 315 (Umschriebene
Entwicklungsrückstände). Zu jeder dreistelligen Zahl gehören 5 - 10 einzelne Diagnosen
(ICD-9 1988).
Die neue, 10. Revision der ICD (ICD-10 1992) enthält
wesentlich mehr solche Risiko-Diagnoseklassen: Entwicklungsstörungen bezüglich
Schulleistungen (F 81), Störungen der sozialen Funktion, spezifischer Beginn in Kindheit
und Jugend (F 94, eine solche Krankheit ist z.B. das Nasenbohren), anormale Befunde bei
der Urinuntersuchung (R 80 - R 82), anormale Befunde bei anderen Körperflüssigkeiten,
Substanzen und Geweben, ohne Diagnose (R 83 - R 89), persönliche Geschichte von
Risikofaktoren (Z 91). Einige Diagnosen aus dieser Zehnten Revision treffen auch dann auf
mich zu, wenn ich mich glänzend fühle: Konstitutionell hohe Statur (E 343.4 ), Mäßige
Protein-Mangelernährung (E 44.1), Koffein-Abhängigkeits-Syndrom (F 15.2).
Wenn ich wegen eines solchen Risikos nichts
unternehme, bin ich falsch beraten. Denn mit Statistikprogrammen können Forscher
Zusammenhänge zwischen Risiko und Krankheit herstellen. Etwa zwischen bestimmten
Schulleistungen und der Wahrscheinlichkeit, verrückt zu werden; zwischen der Anzahl der
Kinder, die eine Frau zur Welt gebracht hat, und sogenannten Fehlbildungen ihrer
Neugeborenen; zwischen Ernährungszustand und Lebenserwartung. Mediziner, z.B. die
Erforscher menschlicher Erbanlagen, entdecken viele verschiedene Gesundheiten, die man
haben kann. Schon dem Säugling bei der Vorsorgeuntersuchung werden Eigenschaften
zugeschrieben, die er nie wieder verliert.
Man braucht viele Datenspender, um statistisch zu
beweisen, daß ein Gen, ein Verhalten, eine “Störung” oder ein “abnormaler
Befund” zur Krankheit führt. Vorsorgeuntersuchungen, Reihenuntersuchungen von
Schwangeren, von Neugeborenen und Arbeitnehmern sind ergiebige Datenquellen
(Bertrand/Kuhlmann 1994). Zukünftig soll die Gesundheits-Chipkarte zur Kontrolle
eingesetzt werden, ob Schwangere und Mütter von Kleinkindern sich regelmäßig
untersuchen lassen, ob jeder Versicherte über 40 zur Krebsvorsorge geht. Die Karte ist
Bestandteil eines elektronischen Daten-Sammel-Systems, demnächst wird es mit ihrer Hilfe
Datenbanken mit jeweils Dutzenden von Gesundheits- und Lebensdaten über Millionen von
Versicherte geben. Damit kommt man ohne großen Aufwand kleinsten “Risiken” auf
die Spur. Ein Schritt in diese Richtung sind bundesweite Register für Fehlbildungen von
Neugeborenen, und die Krebsregister, die zur Zeit geplant sind. Auch wenn die Daten
anonymisiert werden: über den Umweg der Statistik wirken sie auf das Individuum zurück.
Denn in einer Risikogruppe zu sein, kann gravierende
Folgen haben: Der Schularzt fordert bei der Einschulung das Kindervorsorge-Heft an, die
frühkindlichen Untersuchungen beeinflussen die Schullaufbahn. Die Krankenkasse rät
Risikopersonen zur Therapie und zu einem anderen Lebensstil. Die private Versicherung
verlangt höhere Beiträge, oder sie weigert sich - z.B. bei Verdacht auf Homosexualität
- Verträge abzuschließen. Der Frauenarzt rät zum Abbruch der “genetisch
riskanten” Schwangerschaft. Die Arbeitnehmerin mit “genetischem Risiko”
wird - nach dem Regierungsentwurf zum Arbeitsschutzgesetz - an einen anderen Arbeitsplatz
versetzt oder entlassen. Wer nicht Risiken vermeidet, wer Ski fährt oder raucht, trotz
Übergewicht keinen Sport treibt, nicht zum Zahnarzt geht, soll mehr bezahlen. Die
Gemeinschaft der Versicherten könne schließlich nicht die Kosten des
“unverantwortlichen Verhaltens” tragen.
Dem medizinisch gesteuerten Leben könnte in Zukunft
große Wichtigkeit zukommen. Religiöse und politische Ideologien liefern den meisten
Menschen keine ausreichende Erklärung mehr für ihr Schicksal. Religion, politische
Haltung, Geschlecht oder Herkunft werden nicht mehr als Erklärung für die eigene
Lebenssituation herangezogen. Doch verschiedene Lebenschancen, fast unüberwindliche
Schranken gibt es immer noch in unserer Gesellschaft. Medizin und Psychologie sind im
Begriff, diese Lücke zu füllen. Bekannte erklären mir, daß sie durch eine Therapie
jetzt ihre wahren Bedürfnisse verstanden hätten. Arbeitslose, Streßopfer und
Benachteiligte sehen oft bei sich selbst ein medizinisches oder psychisches Problem - wie
z.B. die hysterischen Frauen im 19. Jahrhundert. Schon meinen Genetiker, für
Alkoholismus, Schizophrenie und Kriminalität gebe es erbliche Risikofaktoren.
Gerade die Personenkreise, die einmal mit
Vorsorgemedizin geschützt werden sollten, werden durch die Risiko-Vorsorge ausgegrenzt.
Empfindliche Arbeitnehmer an giftigen Arbeitsplätzen werden nicht geschützt, man nimmt
ihnen den Arbeitsplatz. Arme, die ungesünder arbeiten und leben als Wohlhabende, bekommen
nicht etwa mehr Geld, sie sollen mehr zahlen für ihren Versicherungsschutz. Behinderte
werden als vermeidbar hingestellt, Homosexuelle ausgegrenzt, Straffällige als unheilbar
weggesperrt. US-Gewerkschaften, die früher Präventionsprogramme unterstützt haben,
raten jetzt den Beschäftigten, sich nicht mehr untersuchen zu lassen. In Deutschland
käme eine solche Warnung womöglich zu spät. Denn eine Pflicht zu Risiko-Untersuchungen
gehört zu den Plänen, die Bundesgesundheitsminister Seehofer für die dritte Stufe der
Gesundheitsreform angekündigt hat. Jede und jeder Versicherte soll mindestens einmal
jährlich zum Arzt. “Wenn sich herausstellt”, so Seehofer im Juli 1994 in einem
Interview, “daß der Versicherte durch gesunde Ernährung, notwendige Hygiene,
regelmäßige Bewegung, Verzicht auf Nikotin und weitgehenden Verzicht auf Alkohol zu
seiner eigenen Gesundheit aktiv beiträgt, soll er weniger Selbstbeteiligung im
Krankheitsfall und weniger Versicherungsbeitrag zahlen.” Im gleichen Atemzug forderte
Seehofer die direkte Ankopplung der Ärzte an die Großrechner der Krankenkassen. Sie
wäre erforderlich, um die Meldungen über den Gesundheits-TÜV technisch zu handhaben.
Wenn jeder sein Leben lang Patient ist und ärztlich
betreut wird, kostet das Geld. Das ist das Thema der Gesundheitsökonomen. In der
Gesundheitspolitik ist ihr Wort in den letzten zehn Jahren immer wichtiger geworden. Die
elektronische Zuteilung von Gesundheitsleistungen soll nach ihren Vorschlägen in Zukunft
nach neuen Maßstäben geschehen: denen von Ökonomie und Bioethik. Berichte des
“Sachverständigenrates für die konzertierte Aktion im Gesundheitswesen” sind
zur Leitlinie der Gesundheitsreformen geworden. Darin haben die Gesundheitsökonomen ihre
Argumente schon durchgesetzt.
Gesundheitsökonomen und Ärzte profitieren von einem
Dogma der Neuzeit: niemand darf etwas wichtiges nur deswegen bekommen, weil er es will.
Das wäre die Ökonomie der Bedürfnisse. Das Gesetz der Marktwirtschaft ist aber
Knappheit. Wenn jemand sich etwas wertvolles nicht kaufen kann, muß wenigstens
wissenschaftlich festgestellt werden, daß er es braucht (Stone 1993: 52). Bei der
Gesundheit soll nicht das Geld darüber entscheiden, ob man behandelt wird. Aber, wenn
weder das Geld entscheiden soll, noch der bloße Wunsch des Einzelnen ausreicht, was dann?
Bisher haben “objektive Befunde” entschieden. Wenn Ärzte uns krank schreiben,
dürfen wir zu Hause bleiben, sonst nicht. Wenn ihr Befund es verlangt, behandeln sie uns,
sonst nicht. Nur, wenn sie es sind, die uns Medikamente verschreiben, uns ins Krankenhaus
einweisen, bekommen wir, was wir wünschen. Sie sollen uns nur dann etwas geben, wenn wir
es wirklich brauchen. Wenn aber jeder ein gesunder Kranker ist, wenn Krankheit nichts
objektives mehr ist, wird das schwierig. In der Medizin hat sich beinahe die Ökonomie der
Bedürfnisse durchgesetzt.
Das war die Chance der Gesundheitsökonomen: Sie
wollen jetzt die angeblich knappen “medizinischen Güter” verteilen. Ihre erste
Forderung ist, sie wieder an die zu verkaufen, die zahlen können. Dazu schlagen sie
verschiedene Versichertenklassen und die Ausgrenzung von Leistungen vor. Aber nach welchen
Kriterien sollen die Leistungen ausgewählt werden, die die Versicherung noch zahlt; wie
sollen diejenigen Versicherten ausgewählt werden, die Leistungen erhalten? Die Medizin
hat keine Maßstäbe dafür. Gesundheitsökonomen bringen da eine neue Wissenschaft ins
Geschäft: die Bioethik. Ihr Vorschlag: Was uns am glücklichsten und längsten leben
läßt, wird noch bezahlt. Was weniger Glück und langes Leben bringt, muß jeder selbst
kaufen (Arnold 1993: 163 - 165). Aber was das Glück ist, und wie viel Lebensdauer man
durch eine Behandlung erwerben kann, dürfen Patienten nicht selbst einschätzen, die
Bioethiker stellen es objektiv fest. Sie berechnen die Qualität und Lebenserwartung, die
unser Leben durch eine Behandlung statistisch bekommt. Da Alte und Behinderte angeblich
nicht so glücklich sind wie Junge, Nichtbehinderte, und vielleicht kürzer zu leben
haben, erhalten sie weniger Leistungen. Die Normen der Bioethik sollen zu
Qualitätsmaßstäben der Medizin werden, indem ermittelt wird, welche Behandlung objektiv
für welche Gruppe von Patienten die beste ist, also welche ihnen mit dem gegebenen Geld
die höchste “Lebensqualität” verschafft (v. d. Schulenburg u.a. 1994). Eines
Tages werden das Richtlinien für Ärzte sein, deren Einhaltung per EDV überwacht wird.
Um solche Qualitäts-Berechnungen anzustellen, werden
sehr große Datenmengen aus dem “Leistungsgeschehen” gebraucht. Man benötigt
Liegezeiten im Krankenhaus, Alter der Patienten, Kosten der Operationen und den weiteren
Krankheitsverlauf für Tausende von “Fällen”. Erst mit Hilfe der
Krankenversichertenkarte und der Vernetzung im Gesundheitswesen können diese Daten
gesammelt und genutzt werden. Die Krankenversichertenkarte verwandelt den
unverwechselbaren einzelnen Versicherten in den statistischen Versicherten, der
Arztcomputer macht das unverwechselbare einzelne Gespräch oder die Operation zur
statistisch verwertbaren Behandlungsinformation. In dieser “zweiten Realität”
werden neue Tatsachen hergestellt, die sich auf den unverwechselbaren Versicherten
auswirken: es wird festgestellt, wieviel man noch in ihn investieren soll und kann.